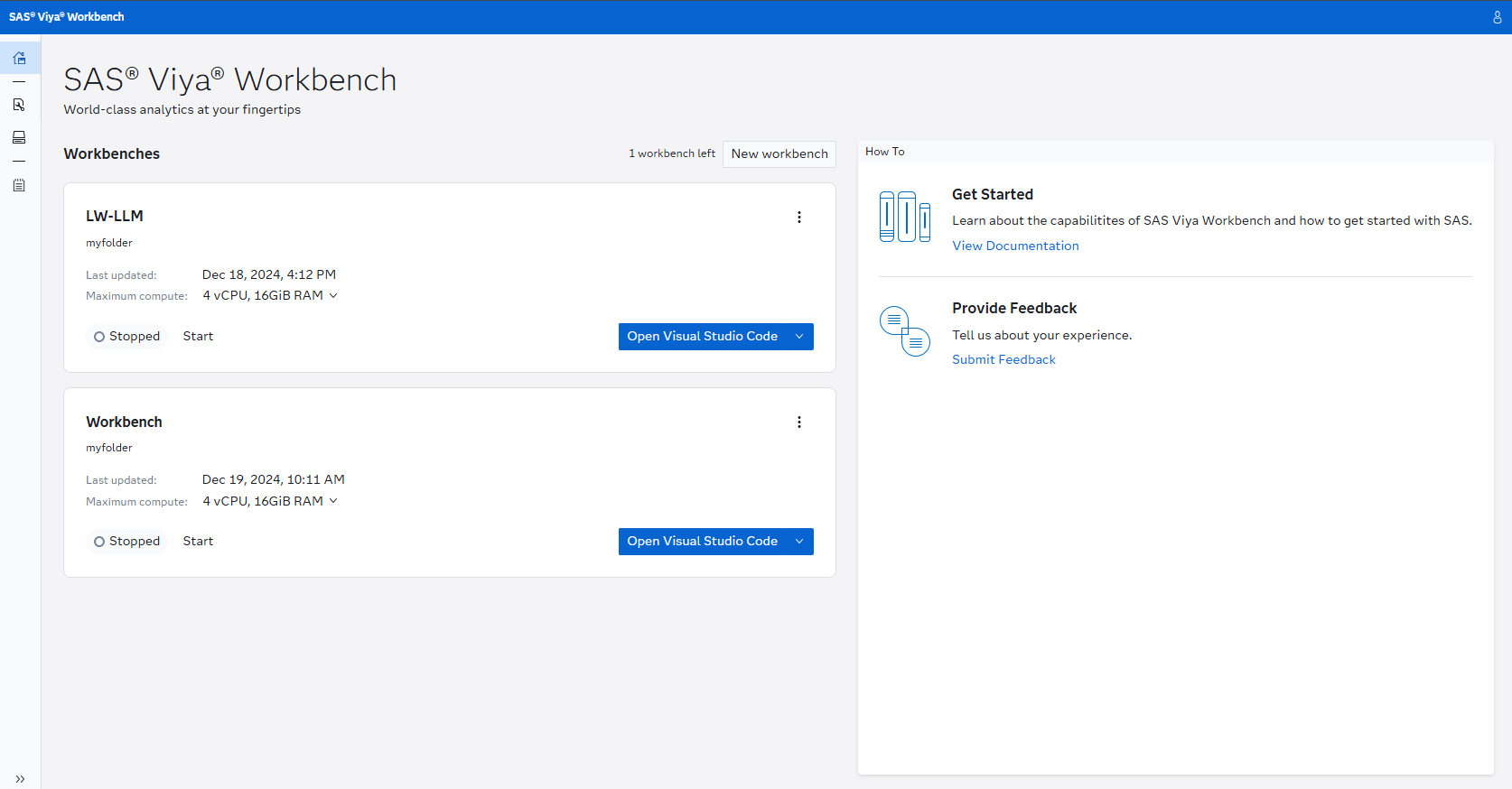Die Springer-WG im Silicon Valley wurde zunächst belächelt und beargwöhnt. Hat es das schon einmal gegeben? Ein deutscher Konzern schickt eine Handvoll seiner Top-Manager für einen längeren Aufenthalt in eine andere Weltgegend mit dem Auftrag, die Geschäftsmodelle der Zukunft zu sondieren. Herausgekommen sind ikonisch gewordene Bilder eines Vollbart tragenden Kai Diekmann, der den damals jungenhaften deutschen Wirtschaftsminister Philipp Rösler umarmt – und eine Reihe auch veröffentlichter Erkenntnisse. Sehr lesenswert das Ende 2014 erschienene Buch von Christoph Keese. Eine Rezension.
Keese gelingt in seinem Buch ein seltenes Kunststück. Zum einen berichtet er von seinen persönlichen Begegnungen mit dem berühmten Tal, in dem unsere Zukunft maßgeblich gestaltet wird. Er beschreibt diese Annäherung durchaus aus der Perspektive des Staunenden und dann immer wieder neu Faszinierten. Zum anderen abstrahiert er gleichzeitig, und das ist nicht einfach, das Gesehene und bringt es in größere volkswirtschaftliche, ja informationstheoretische Zusammenhänge. Daraus erwächst eine große Glaubwürdigkeit: Jede große These wächst aus einem konkreten Beispiel und wird durch die kritische Prüfung in einen Gesamtzusammenhang gestellt.
![]() Heraus kommt einiges: eine Tour d´Horizon über alle wesentlichen Aspekte des Silicon Valley, eine Analyse der wesentlichen Geschäftsmodelle und konkrete Hinweise, was sich in Deutschland ändern muss, um Ähnliches auch hierzulande zu erreichen.
Heraus kommt einiges: eine Tour d´Horizon über alle wesentlichen Aspekte des Silicon Valley, eine Analyse der wesentlichen Geschäftsmodelle und konkrete Hinweise, was sich in Deutschland ändern muss, um Ähnliches auch hierzulande zu erreichen.
Was macht das Silicon Valley aus?
Eine wesentliche Rolle spielt die Stanford Universität, die für einen steten Nachschub an wissbegierigen und hochbegabten Köpfen sorgt und zudem einiges an Infrastruktur bereitstellt. So wird neben der wissenschaftlichen Exzellenz zum konkreten Umsetzen animiert. Dort, wo die Harvard Business School an Fallbeispielen theoretische Diskurse führt, setzt Stanford auf die praktische Umsetzung. Dazu kommen glückliche Zufälle wie die Ansiedlung des D-Labs, das mit seinem Design-Thinking-Ansatz Innovationsprozesse ganz neu interpretiert und orchestriert.
Daneben sorgt das Vorhandensein von Venture Capital und die räumliche Nähe der Kapitalgeber für einen optimierten Technologietransfer. Es ist nicht ausgemacht, wer hier eigentlich um wen kämpft: die Geldgeber um die besten Geschäftschancen oder die Gründer um Startkapital. Das scheint auch der signifikanteste Unterschied zu deutschen Verhältnissen zu sein. In Deutschland sind ganz klar die Gründer die Bittsteller – und in der Regel geht es um Fremdkapital, das nach Risikokriterien sehr zurückhaltend vergeben wird. Im Silicon Valley wird dagegen chancenorientiert auf Ideen gewettet. Nur eine von zehn Investitionen wird sich rechnen. Man weiß nicht welche, aber deshalb muss jede einzelne Idee auf Größe zielen und mit ihrem Potenzial auch die Verluste der anderen ausgleichen.
Die Gründer und deren unbedingter Ehrgeiz sind das dritte und wesentliche Element. In einem gnadenlosen Wettbewerb setzen sie alles daran, möglichst schnell mit ihrer neuen Lösung für ein möglichst großes Problem an den Markt zu kommen. Durchgesetzt hat sich dabei eine Art Rapid Prototyping (Keese nennt es das „minimum viable product“): lieber mit einem durchdachten, aber begrenzten Funktionsset starten und dann basierend auf Nutzerfeedback weitere Entwicklungen vornehmen. Diese Änderungen gehen im äußersten Fall bis zu einer kompletten Umkehrung der Ursprungsidee.
Die wesentlichen Geschäftsmodelle
Ein verbindendes Element ist die Dominanz von Software. Keese zitiert den berühmten Satz von Marc Andreesen, dem Netscape-Gründer und langjährigem Venture-Capital-Geber für viele Start-ups: „Software is eating the world.“ Die Digitalisierung schafft einen immer höheren Anteil von Wertschöpfung durch intelligente Programmierung – in der Hauptsache von Plattformen. Die entstehenden Plattformen bringen bisher getrennt voneinander agierende Marktteilnehmer auf eine effiziente Weise zusammen. Populär sind etwa eBay und Amazon für Konsumgüter. Keese nennt als sehr überzeugendes Beispiel eine Stahlhandelsplattform, die vom etablierten Stahlhändler Klöckner aufgebaut und betrieben wird. Der Klöckner-CEO will lieber selbst zum Disruptor seines eigenen Unternehmens werden, als dass sich ein fremder Dritter – ein Silicon-Valley-Start-up – dessen annimmt.
Plattformen profitieren von Netzwerkeffekten. Je mehr Teilnehmer ein Netzwerk hat, desto größer ist auch der Nutzen für jeden Einzelnen. In der realen Welt trifft dies etwa auf das Telefon oder Fax zu. In der neuen digitalen Welt lassen sich rein informationsbasierte Netzwerkeffekte kaum mehr ändern oder angreifen: „The winner takes it all.“ Es lohnt sich einfach nicht mehr, sich einem Monopolisten wie Google oder Facebook mit einer ähnlichen Idee entgegenzustellen, weil die Netzwerkvorteile für die bisherigen Nutzer einen so enormen Vorteil bringen.
Hier operiert Keese immer stärker auch aus der Sicht des Axel-Springer-Konzerns, dem er als eine maßgebliche Führungskraft ja angehört. Trotzdem bleibt er jederzeit objektiv und belegt ein ums andere Mal, auf welche Weise Google seine Marktmacht missbraucht und mit der Dominanz in der einen Kategorie („Suche“) neue Dienste („Maps“, „Bilder“, „Shopping“, etc.) anschiebt und seinerseits zu Netzwerkeffekten verhilft. Ohne die Bevorzugung der Youtube-Videos in der Google-Ergebnisliste bei Suchanfragen könnten sich andere Videoplattformen sicherlich eines größeren Zuspruchs erfreuen.
Was muss in Deutschland passieren?
Die Beschäftigung mit Google, aber auch die jüngste Steuerdiskussion um Apples Milliardengewinne zeigen deutlich, dass die großen Internetkonzerne längst in einer eigenen Liga spielen. Wer soll diese noch kontrollieren? Wer kann sicherstellen, dass kein Missbrauch ihrer stetig steigenden Macht erfolgt? In diesem Sinne betreten Regierungen „Neuland“. Dieses Wort scheint von Keese erfunden und womöglich von da in die Bundesregierung gerutscht zu sein. Und es ist in der Tat Neuland, wenn ausgerechnet ein marktliberaler Vordenker und Wirtschaftsjournalist nach einem starken Staat ruft, damit dieser regulierend eingreift.
Noch wichtiger aber ist der Hinweis auf eine veränderte Arbeitskultur. Im Valley gehört es sozusagen zum guten Ton, bereits einmal gescheitert zu sein. Auch werden dort in großer Offenheit Details eines Geschäftsmodells mitgeteilt und um Feedback gebeten. Denn nichts ist teurer und ineffizienter, als erst nach Start eines Angebots feststellen zu müssen, dass es am Markt vorbei produziert wurde. In Deutschland herrsche hingegen eine Kultur des Geheimhaltens bis zum letzten Moment. In den neuen Start-ups sitzen die Kernteams in einem Raum, häufig an einem Tisch, und tauschen sich unablässig aus. Zusammenarbeit und kreatives Denken werden dabei ganz anders definiert als in traditionellen Forschungs- und Innovationsabteilungen (Stichworte wären da sicherlich „Design Thinking“ oder „Lab“).
Ein wesentlicher Punkt für Keese ist auch die gesamte Struktur der steuerlichen Behandlung von Venture Capital. Hier sieht er die Politik in der Pflicht, die zwar verdienstvolle Existenzgründerinitiativen startet, aber doch nicht die wesentlichen Rahmenbedingungen für ein vergleichbares Ökosystem schafft.
Fazit
Ein sehr lesbares, immer noch hochaktuelles Buch, das leicht verständlich, aber auch sehr tiefgründig wesentliche Aspekte der aktuellen Innovationsdiskussion aufgreift. Dieses Buch hat sicherlich einen gehörigen Anteil an der Reisetätigkeit deutscher CEOs ins Silicon Valley und wird auch die eine oder andere Lab-Gründung in Berlin mit getrieben haben. Denn eines ist klar – abschließend sei das Motto des Buches zitiert: „Was digitalisiert werden kann, wird digitalisiert werden“ (Carly Fiorina, Ex-HP).
Christoph Keese ist Keynote-Speaker in der dritten Ausgabe des Big Data Analytics Forums, das SAS am 22.11. in Frankfurt, am 30.11. in Zürich und am 1.12. in Wien veranstaltet. Die Anmeldung ist kostenlos, die Teilnehmerzahl begrenzt.